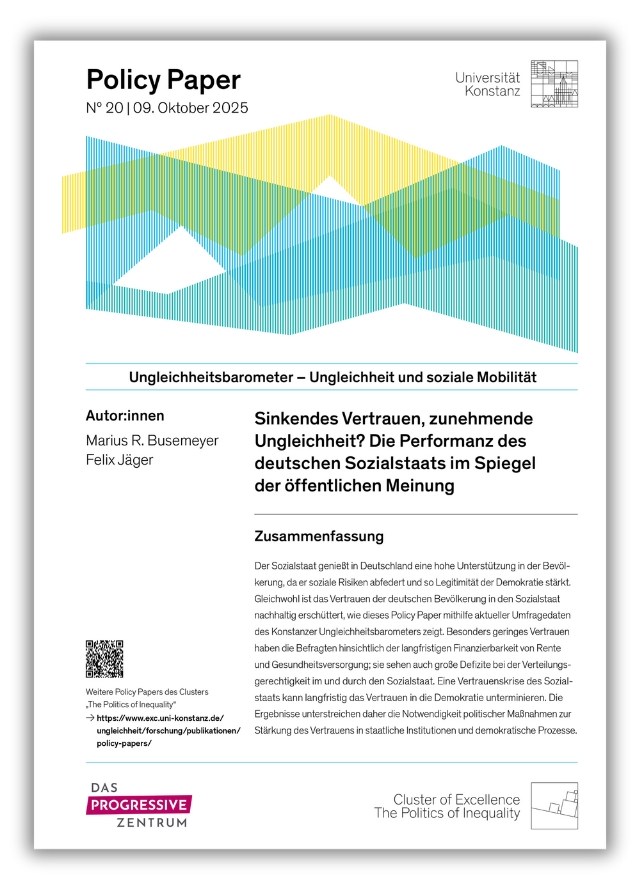Der Sozialstaat in Deutschland sowie in anderen Ländern erfreut sich weithin einer hohen Beliebtheit und breiter Unterstützung durch Politik und Gesellschaft. Sozialpolitische Programme wie Rente, Gesundheit, Arbeitsmarkt- sowie Bildungs- und Familienpolitik federn die negativen Auswirkungen von wirtschaftlichen Krisen und sozialen Risiken auf der individuellen und kollektiven Ebene ab. Durch diese mehr oder weniger umfassende Absicherung sichert der Sozialstaat die politische Legitimation der demokratischen Marktwirtschaft und generiert langfristiges Vertrauen der Bürger:innen in das politische System.
Im Umkehrschluss bedeutet dies jedoch auch, dass ein Verlust des Vertrauens in die Funktionsfähigkeit und Fairness des Sozialstaats Rückwirkungen auf das Vertrauen der Bürger:innen in Staat und Demokratie haben könnte. Der Sozialstaat trägt einerseits durch soziale Transfers und Dienstleistungen wesentlich zur Reduzierung von sozialer und ökonomischer Ungleichheit bei; er kann jedoch selbst auch neue Verteilungskonflikte erzeugen – insbesondere in Zeiten knapper öffentlicher Haushalte. Wenn die (Um-)Verteilung von Ressourcen durch den Sozialstaat als unfair, ineffizient oder langfristig nicht finanzierbar wahrgenommen wird, erodiert das Vertrauen in die Leistungsfähigkeit des Staates und damit auch das Vertrauen in die Politik.
Dieses Policy Paper untersucht mit Umfragedaten aus der neuesten Welle des Konstanzer Ungleichheitsbarometers die individuellen Wahrnehmungen der deutschen Wohnbevölkerung hinsichtlich der Fairness und Performanz des deutschen Sozialstaates. Generell zeigen die Daten, dass die Bürger:innen seine langfristige Nachhaltigkeit ausgesprochen kritisch sehen. Dies gilt in besonderer Weise für die Bereiche Rente und Gesundheitsversorgung. Die Befragten nehmen außerdem starke Defizite in Bezug auf die Verteilungsgerechtigkeit innerhalb des Sozialstaates wahr. Wir diskutieren die politischen Implikationen dieser Befunde im abschließenden Abschnitt dieses Papiers.
Schlussfolgerungen und politische Implikationen
Die in diesem Policy Paper dargelegte Untersuchung hat verschiedene Indikatoren einer tief sitzenden Vertrauenskrise der Bürger:innen in den deutschen Sozialstaat identifiziert und analysiert. Diese Vertrauenskrise umfasst verschiedene Dimensionen – von allgemeinen Performanz-Wahrnehmungen über Fairness bis hin zu Fragen der langfristigen Finanzierbarkeit von Sozialleistungen – und verschiedene Teilbereiche des Sozialstaats. Trotz dieser Tatsache scheinen vor allem die Bereiche Altersrente und Gesundheitsversorgung besonders betroffen zu sein.
Unsere Daten zeigen auch, dass die Menschen in Deutschland den Sozialstaat nicht automatisch und zwangsläufig als ungleichheitsmindernde Institution wahrnehmen. Vielmehr kann er selbst neue Verteilungskonflikte produzieren – insbesondere dann, wenn eine selektive Bevorzugung oder Benachteiligung unterschiedlicher Gruppen wahrgenommen wird.
Die Vertrauenskrise in den Sozialstaat kann langfristig zu einer Vertrauenskrise in die Politik führen. Frühere Forschungsarbeiten des Exzellenzclusters zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie haben zwar gezeigt, dass generalisiertes politisches Vertrauen ziemlich stabil ist und selbst Krisen wie die Pandemie überstehen kann, auch wenn die Kritik am kurzfristigen Krisenmanagement wächst. Über lange Zeiträume betrachtet kann sich eine Abwärtsspirale aus erodierendem Vertrauen in die Leistungsfähigkeit des Sozialstaates aber durchaus übertragen auf Misstrauen in die Leistungsfähigkeit und damit die Legitimität demokratischer Politik.
Handlungsempfehlungen
Welche politischen Handlungsempfehlungen lassen sich aus den erzielten Befunden ableiten?
Erstens sollte es vordringlich darum gehen, das verloren gegangene Vertrauen in die Leistungsfähigkeit des Sozialstaates wiederherzustellen. Die Bereiche Rente und Gesundheit sind hierfür von zentraler Bedeutung und sollten daher in der reformpolitischen Agenda höchste Priorität haben. Die größtenteils demografisch bedingte Kombination aus steigenden Kosten, sinkendem Leistungsniveau und steigender Unsicherheit bei der Altersvorsorge der jüngeren Generationen hat sicherlich zu einer Erosion des Vertrauens in die Rente beigetragen. Reformstrategien sollten daher nicht nur darauf zielen, eine gute Balance zwischen den legitimen Interessen der unterschiedlichen Generationen zu finden, sondern auch darauf, durch gute Kommunikation und positiv besetzte Narrative das Vertrauen in das Rentensystem wiederherzustellen.
Zweitens deuten die Befunde zu den gruppenbezogenen Wahrnehmungen von Bevorzugung und Benachteiligung durch den Sozialstaat auf eine Diskrepanz zwischen subjektiven Wahrnehmungen und objektiven Tatsachen hin. Um ein Beispiel herauszugreifen: Obwohl heutige Rentner:innen ein hohes Maß an finanzieller und auch symbolischer Unterstützung durch den Sozialstaat erfahren, werden sie als benachteiligt wahrgenommen. Im Gegensatz dazu werden die relativ kleinen Minderheiten der Arbeitslosen und Geflüchteten als unfairer Weise bevorzugt wahrgenommen, obwohl sie in Bezug auf das individuelle Niveau ihrer gruppenbezogenen Sozialleistungen sowie der Gesamthöhe der Ausgaben für diese Bereiche des Sozialstaates wesentlich weniger Ressourcen in Anspruch nehmen als das Renten- oder Gesundheitssystem. Auch hier sollte in der politischen Kommunikation darauf geachtet werden, potenziell verzerrte subjektive Wahrnehmungen durch systematische Konfrontation mit objektiven Tatsachen herauszufordern. Dies ist deswegen von essenzieller Bedeutung, weil letztlich die subjektiven Wahrnehmungen das Wahlverhalten in zentraler Weise beeinflussen.
Hintergrundinformationen zur Erhebungsmethode
Die Veröffentlichung des Policy Papers „Sinkendes Vertrauen, zunehmende Ungleichheit? Die Performanz des deutschen Sozialstaats im Spiegel der öffentlichen Meinung“ erfolgt in Zusammenarbeit zwischen dem Exzellenzcluster „The Politics of Inequality” an der Universität Konstanz und dem Berliner Think-Tank Das Progressive Zentrum. Die Daten wurden im Rahmen einer Online-Befragung der über-18-jährigen Wohnbevölkerung in Deutschland zwischen dem 11. November und 5. Dezember 2024 erhoben. Insgesamt nahmen 6.152 Befragte teil.
Autor:innen
Auf dem Abstellgleis? Zum Zusammenhang zwischen Ungleichheitswahrnehmungen und politischer Beteiligung
Deutsche unterschätzen ungleiche Verteilung von Einkommen und Vermögen erheblich
Die heilige Kuh des deutschen Steuerrechts
Sozialtransfers, Weiterbildung, kürzere Arbeitszeiten?
Auf dem Abstellgleis? Zum Zusammenhang zwischen Ungleichheitswahrnehmungen und politischer Beteiligung

Wir entwickeln und debattieren Ideen für den gesellschaftlichen Fortschritt – und bringen diejenigen zusammen, die sie in die Tat umsetzen. Unser Ziel als Think Tank: das Gelingen einer gerechten Transformation. ▸ Mehr erfahren