Mehr verschieden als vereint?
Im Juni 2024 werden EU-Bürgerinnen und -Bürger zum zehnten Mal zu den Urnen gehen, um ihre Vertreter im Europäischen Parlament zu wählen. Die Wahlen zum Europäischen Parlament sind zwar nach wie vor „Wahlen zweiter Ordnung“, bei denen die nationalen Parteien auf der Grundlage innenpolitischer Themen miteinander konkurrieren, aber die Wahl 2024 findet in einem besonders turbulenten Umfeld statt, das die Abstimmung erheblich beeinflussen könnte. Angesichts des immer noch andauernden russischen Angriffskriegs in der Ukraine und an den Grenzen der EU, des ungewissen Ausgangs der Wahlen in den USA im November 2024 und der zunehmenden Spannungen zwischen den USA und China mit all den vielfältigen Folgen dieser Krisen und der laufenden Polytransition steht bei den kommenden Wahlen wohl mehr auf dem Spiel als je zuvor. Die Gerüchteküche läuft bereits auf Hochtouren und warnt davor, dass die extreme Rechte das politische Establishment an den Wahlurnen erschüttern und bis zu einem Viertel der Sitze in der nächsten Europäischen Versammlung einnehmen könnte.
Wie gehen die politischen Parteien in ihren Programmen und Wahlkämpfen mit den komplexen Herausforderungen der heutigen Zeit um – und wie unterscheiden sie sich dabei? Welche Themen dominieren die Debatten? Wie werden sich die Ergebnisse auf das Kräfteverhältnis im nächsten Europäischen Parlament und anderen EU-Institutionen auswirken? Was werden die politischen Auswirkungen sein? In diesem Projekt versuchen wir, diese Fragen zu beantworten, indem wir uns auf eine Reihe wichtiger Mitgliedsstaaten in vergleichender Perspektive konzentrieren.
Über das Projekt

Von Anfang 2024 bis zum Herbst beobachten, vergleichen und analysieren wir zusammen mit mehreren europäischen Think Tanks und Forschungsorganisationen auf der Grundlage eines gemeinsamen methodischen Ansatzes die Wahlkämpfe und -ergebnisse in vier großen Mitgliedstaaten – Frankreich, Deutschland, Italien und Polen. Wir diskutieren auch die aggregierten Ergebnisse aus einer EU-Perspektive.
Das Projekt zeigt Gemeinsamkeiten und Unterschiede bei politischen Themen und öffentlichen Debatten in der EU auf, offenbart ideologische und themenbezogene Spaltungen und vergleicht die Einstellungen der Bürger in den verschiedenen untersuchten Ländern. Es gibt Aufschluss darüber, wie es um die Demokratien in den wichtigsten EU-Mitgliedstaaten bestellt ist und welche Trends die Entscheidungen der EU im neuen Politikzyklus beeinflussen. Sie untersucht auch, wie sich die Wahlen auf die politische Richtung der nächsten europäischen Führung auswirken werden, indem sie Hinweise auf die Aussicht auf neue Initiativen und politische Reformen gibt, mögliche Hindernisse für Vertragsreformen aufdeckt und gemeinsame Positionen der vier untersuchten Länder aufzeigt. Die Forschungsgruppe erörtert auch, inwieweit Kampagnen mit nationalen Themen verbunden oder europäisiert sind und ob ein Zusammenhang zwischen Wahlbeteiligung und Wahlthemen hergestellt werden kann.
Die Forschungsergebnisse werden in separaten Länderberichten vorgestellt. Darüber hinaus wird bis September 2024 ein Abschlussbericht veröffentlicht, der auch ein EU-Kapitel und Empfehlungen enthält.
Die Forschungsergebnisse werden auch bei nationalen Rundtischgesprächen in den verschiedenen Hauptstädten sowie bei einem Rundtischgespräch und einer Eröffnungskonferenz in Brüssel diskutiert werden.
Das Projekt zielt darauf ab, eine einzigartige europäische Perspektive auf die Wahlkampagnen und -ergebnisse zu schaffen und Erkenntnisse für EU- und nationale Akteure zu liefern, die die EP-Wahlprozesse verbessern und europäisieren möchten. Es versucht auch, die Arbeit von Think Tanks in ganz Europa zu europäisieren.
Der Abschlussbericht ist auf Englisch verfasst. Der Länderbericht zur EU-Wahl in Deutschland ist jedoch auch auf Deutsch verfügbar.
Projektpartner & Forschende
Das Projekt wird in gemeinsamer Zusammenarbeit zwischen Das Progressive Zentrum (Berlin, Deutschland) und dem European Policy Centre (Brüssel, Belgien) durchgeführt. Darüber hinaus umfasst es die folgenden Partnerorganisationen: Istituto Affari Internazionali (Italien), Terra Nova (Frankreich) und Krytyka Polityczna (Polen), die spezifisches Fachwissen bereitstellen, um eine umfassendere europäische Perspektive zu ermöglichen.

Sophie Pornschlegel, strategische Leiterin des Projekts zur Wahl des Europäischen Parlaments, ist Policy Fellow bei Das Progressive Zentrum und arbeitet derzeit als Studiendirektorin beim Brüsseler Think-Tank Europe Jacques Delors. Sie unterrichtet einen Kurs über europäische Integration an der Sciences Po Paris und ist Autorin des Buches „Am Ende der gewohnten Ordnung: Warum wir Macht neu denken müssen“ (Droemer, 2023). Zuvor arbeitete sie als Senior Policy Analyst am European Policy Centre in Brüssel, wo sie sich in ihrer Forschung auf EU-Institutionen, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit konzentrierte. Sophie studierte Politikwissenschaft und Europäische Angelegenheiten an der Sciences Po Paris, am King’s College London und an der London School of Economics (LSE).

Corina Stratulat ist stellvertretende Direktorin und Leiterin des Programms Europäische Politik und Institutionen am European Policy Centre. Ihre Arbeit am EPC konzentriert sich auf die institutionellen Entwicklungen der EU und die Erweiterung um die Balkanländer. Sie hat einen MPhil in Contemporary European Studies von der Universität Cambridge, UK, und einen PhD in Politik- und Sozialwissenschaften vom Europäischen Hochschulinstitut, Italien. Zu ihren Hauptforschungsinteressen gehören vergleichende mittel- und osteuropäische Politik, Parteien und Parteiensysteme, Wahlen, Demokratie, Populismus, EU-Institutionen, die EU-Integration des Balkans und die Erweiterungspolitik. Gemeinsam mit Eric Maurice wird Corina Stratulat die Brüsseler Perspektive in das Projekt einbringen und die Ergebnisse aus Frankreich, Polen, Italien und Deutschland zusammenführen.

Eric Maurice ist Politikanalyst im European Politics and Institutions Programm des European Policy Centre. Bevor er zum EPC kam, war er Leiter des Brüsseler Büros der Robert-Schuman-Stiftung, einer französischen Denkfabrik, wo er sich mit institutionellen Entwicklungen in der EU, Rechtsstaatlichkeit und strategischen Fragen befasste. Davor berichtete er fast 20 Jahre lang als Journalist für Courrier International, Presseurop und EUobserver über europäische und amerikanische Politik. Eric hat einen MPhil in Zeitgeschichte der internationalen Beziehungen von der Pariser Panthéon-Sorbonne Universität und einen Abschluss von der Pariser Higer School of Journalism. Er ist außerdem Absolvent des Executive Course in European Studies der Nationalen Verwaltungsschule Frankreichs (ENA) und des französischen Instituts für fortgeschrittene Studien der Landesverteidigung (IHEDN).

Luca Barana ist Senior Fellow am Istituto Affari Internazionali (IAI). Seine derzeitigen Forschungsarbeiten am IAI konzentrieren sich auf die Migrationspolitik der EU, die Rolle der Migration in den Außenbeziehungen der EU und der italienischen Außenpolitik sowie die politische Dynamik Europas. Nach seinem Abschluss in Europastudien an der Universität Turin war er Junior Visiting Fellow beim European Council on Foreign Relations (London/Turin) und Programmmanager am Zentrum für Afrikastudien in Turin. Er war Koordinator der Task Force 10 für Migration der T20 – Italien 2021. Vor kurzem hat er den Band „Moving towards Europe“ herausgegeben, in dem die Triebkräfte der Migration und die fragmentierten Migrationsströme in Asien, Afrika und Lateinamerika in Richtung EU analysiert werden.

Marc-Olivier Padis ist derzeit Forschungsdirektor bei Terra Nova. Er ist Herausgeber und Kommentator der französischen und europäischen Politik. Er ist seit fast zwanzig Jahren Chefredakteur und Direktor der Zeitschrift Esprit. Von 2012 bis 2017 trat er regelmäßig in der Sendung „L’Esprit public“ des französischen öffentlich-rechtlichen Rundfunks auf, die von Philippe Meyer moderiert wurde (jetzt online verfügbar unter www.lenouvelespritpublic.fr). Er war Mitglied des Redaktionsausschusses von Eurozine (2009-2015) und 2014 und 2015 als externe Persönlichkeit Mitglied des Verwaltungsrats der Universität Paris 3 Sorbonne-nouvelle. Von 2005 bis 2011 war er Professor an der Sciences Po Paris und lehrte die wichtigsten Themen der europäischen Politik. Er hat mehrere Bücher zur französischen politischen Philosophie (Marcel Gauchet, la genèse de la démocratie, Michalon, 1996) und zu internationalen Themen (Les Multinationales du cœur, mit Thierry Pech, Le Seuil/La République des idées) veröffentlicht.

Maria Skóra ist wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Das Progressive Zentrum. Zuvor war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Europäische Politik und Leiterin des Programms „Internationaler Dialog“ bei Das Progressive Zentrum. Sie hat einen Master-Abschluss in Soziologie und einen Doktortitel in Wirtschaftswissenschaften. 2018 Alumna des Young Leaders Program am Aspen Institute Central Europe in Prag. 2019 Gaststipendiatin beim German Marshall Fund of the United States und AICGS, Johns Hopkins University in Washington, DC. Zuvor arbeitete sie für die Humboldt-Viadrina Governance Platform in Berlin und als Expertin für den All-Polnischen Gewerkschaftsbund in Warschau..

Daniel Schade ist Assistenzprofessor an der Universität Leiden und Policy Fellow bei Das Progressive Zentrum. Er beschäftigt sich mit Fragen der europäischen Politikgestaltung und der Zukunft des Parlamentarismus. Nach seiner Promotion an der London School of Economics and Political Science (LSE) arbeitete er an der Wiener Hochschule für Internationale Studien, der Otto-von-Guericke-Universität und der Cornell University.
Projektteam
Gefördert durch
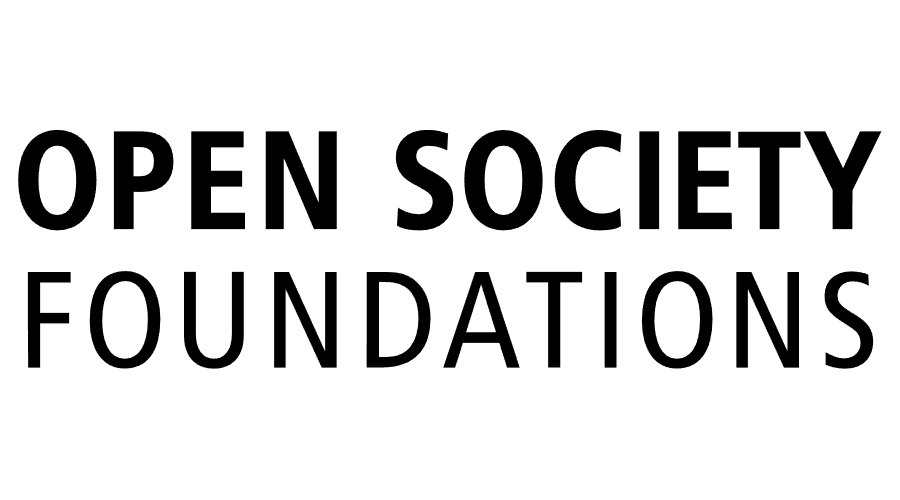

Wir entwickeln und debattieren Ideen für den gesellschaftlichen Fortschritt – und bringen diejenigen zusammen, die sie in die Tat umsetzen. Unser Ziel als Think Tank: das Gelingen einer gerechten Transformation. ▸ Mehr erfahren









