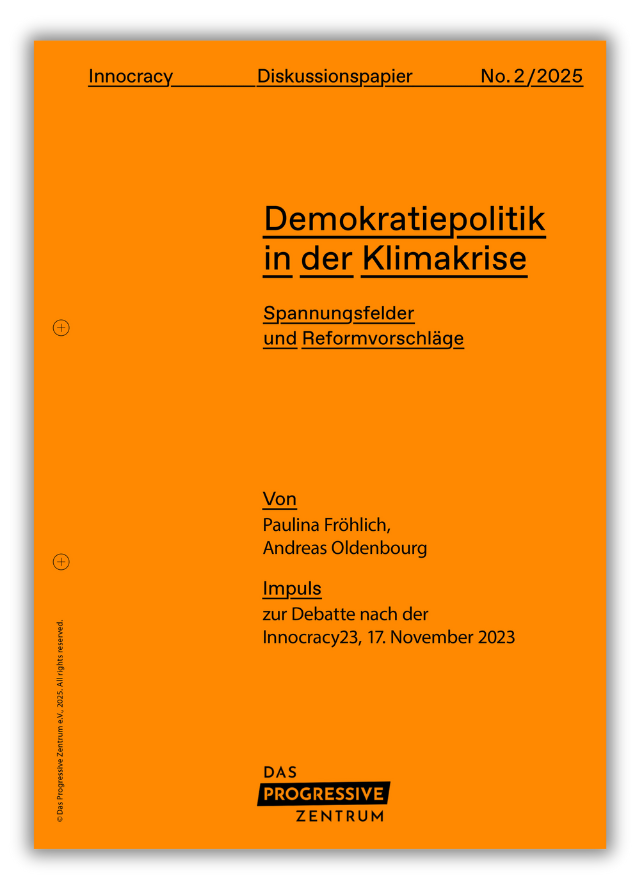Während sich die Klimakrise weiter verschärft, nehmen die Anstrengungen zu ihrer Eindämmung ab. Deutlich wird das am Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD, der die Akzeptanz einer sozial-ökologischen Transformation dadurch zu steigern versucht, dass er Anforderungen an die Bürger:innen abschwächt.
Klimapolitisch wird das vollkommen zu Recht kritisiert. Weder die Wahlgewinnerin Union, noch ihre Koalitionspartnerin SPD haben einen Wahlkampf für mehr Klimaschutz gemacht; auch die negativen Reaktionen auf das Gebäude-Energie-Gesetz (GEG) haben sie vermutlich davon abgehalten. Gründe für die Schärfe dieser Auseinandersetzungen rund um das GEG reichen von handwerklichen Fehlern der verantwortlichen Akteure über ressourcenstarke Vertreter:innen fossiler Interessen bis hin zu den Existenznöten einer vormaligen Regierungspartei, die inzwischen nicht mehr im Deutschen Bundestag vertreten ist.
Darüber hinaus gibt es für Transformationskonflikte aber auch tiefer liegende Ursachen, die sich auf strukturell angelegte Spannungen zwischen Demokratie und Klimakrise zurückführen lassen. Diese strukturellen Ursachen machen wir an vier Spannungsfeldern zwischen Demokratie und Klimakrise fest.
Spannungsfelder
- Geschwindigkeit: Die Klimakrise erzeugt enormen Handlungsdruck. Demokratische Prozesse aber sind langsam, weil es zum demokratischen Selbstverständnis gehört, verschiedene Gruppen anzuhören, sie einzubeziehen sowie Entscheidungen zu prüfen und mehrfach legitimieren zu lassen.
- Generation: Die Klimakrise betrifft besonders junge und zukünftige Generationen. Unsere Demokratie wird jedoch nicht nur von heute Lebenden, sondern in besonderem Maße von älteren Personen bestimmt.
- Gesellschaft: Die Klimakrise betrifft alle Bereiche der Gesellschaft und erfordert deshalb eine umfassende Transformation. Die liberale Demokratie trennt hingegen öffentliche Belange von privatem Leben und Eigentum. Daher reichen ihre institutionellen Mechanismen nicht aus, um Transformationskonflikte demokratisch auszutragen.
- Gebiet: Die Klimakrise ist ein globales Phänomen, unter dem vor allem der Globale Süden leidet. Demokratische Prozesse sind jedoch auf die regionale und nationale sowie – mit Abstrichen – auf
die europäische Ebene beschränkt und deshalb in ihrer Wirkung begrenzt.
Diese Spannungsfelder sollten nicht als unauflösliche Dilemmata missverstanden werden. Vielmehr bieten sie einen analytischen Rahmen, um diese Spannungsfelder durch demokratiepolitische Instrumente und Prozesse abzubauen. Dafür schlagen wir in dieser Publikation ein Bündel zusammenhängender Maßnahmen vor.
Reformvorschläge
Die Vorschläge setzen bei konkreten Defiziten der Demokratie in Deutschland und der EU an und ergänzen sich wechselseitig. Dabei sind viele davon nicht allein auf die Eindämmung der Klimakrise begrenzt, sondern fügen sich in weitergehende Anstrengungen zur Weiterentwicklung der Demokratie ein. Zusammengenommen können diese demokratiepolitischen Reformen dazu beitragen, die Lernfähigkeit der Demokratie zu stärken, um der grundlegenden Herausforderung der Klimakrise besser gerecht zu werden.
Geschwindigkeit
Während die Klimakrise schnell voranschreitet, brauchen demokratische Prozesse Zeit. Damit es dabei nicht zu Blockaden der Transformation kommt, ist bessere und frühere Beteiligung die beste Vorkehrung. Dafür ist ein umfassender Kapazitätsaufbau für rechtzeitige Beteiligung auf Ebene von Bund, Ländern und Kommunen nötig. Kommunen sollten berechtigt sein, sich an Projekten der Energiewende in ihren Gebietskörperschaften zu beteiligen, sofern die betroffenen Bürger:innen dabei partizipieren können. Dies gilt es, mit der Einrichtung dauerhafter Stellen zu verbinden, damit Kommunen Beteiligungsprojekte angemessen
durchführen können.
Die Bundesländer sollten Stellen für Beteiligung in der Transformation einrichten, um Beteiligungsprojekte im jeweiligen Bundesland zu koordinieren und Kommunen bei ihrer Durchführung zu unterstützen.
Auf Bundesebene ist der Deutsche Bundestag in seinen Funktionen als Arbeits- und Redeparlament zu stärken: durch eine Aufwertung des Parlamentarischen Beirats für nachhaltige Entwicklung zu einem Bundestagsausschuss sowie die Einführung von Orientierungsdebatten bei besonders umfassenden und kontroversen Transformationsvorhaben.
Generation
Während der politische Wettbewerb die unmittelbaren Interessen heute lebender und insbesondere älterer Wähler:innen bevorzugt, sind von der Klimakrise vor allem jüngere und künftige Generationen betroffen. Die Stimmen jüngerer Generationen sollten durch eine Absenkung des Wahlalters gestärkt werden.
Die Ansprüche künftiger Generationen auf eine lebenswerte Umwelt lassen sich advokatorisch durch Expert:innen einbringen. Für eine effektivere Interessenvertretung sollten bestehende Expert:innenräte wie der Rat für nachhaltige Entwicklung (RNE), der Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU) der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung für Globale Umweltveränderungen (WBGU) sowie der Expertenrat für Klimafragen (ERK) in einem neuen Rat für Nachhaltigkeit vereinigt werden. Dieser sollte dem Deutschen Bundestag zugeordnet werden, um auch öffentlich eine größere Wirkung entfalten zu können.
Aufgrund seiner Ausrichtung auf Expert:innenwissen ist ein solcher Rat deliberativer orientiert, als es ein Parlament sein kann. Nachhaltigkeit ist dabei als zentraler Wert zur Verwirklichung von Generationengerechtigkeit zu verstehen, der in das Prinzip der Enkeltauglichkeit übersetzt werden kann, um für die breite Öffentlichkeit einen eingängigen Maßstab zu bilden. Bundestag und Bundesregierung müssen verpflichtet sein, auf die Stellungnahmen dieses Rates für Nachhaltigkeit zu reagieren.
Gesellschaft
Während die Transformation als öffentliche Aufgabe auch das Privatleben von Bürger:innen betrifft, trennt die liberale Demokratie öffentliche Belange von privatem Leben und Eigentum. Aufgrund dieser Eigenschaft liberaler Demokratien entzünden sich gesellschaftliche Konflikte besonders häufig an unterschiedlichen Perspektiven darauf, wo die Grenze zwischen privaten Belangen und öffentlichen Angelegenheiten verläuft.
Bürger:innenräte sind besonders gut geeignete Foren, um gesellschaftliche Transformationskonflikte an dieser Grenze konstruktiver auszutragen, da sie einen strukturierten Raum für ausführlichere Debatten bieten, als sie in der Medienöffentlichkeit für die Breite der Bevölkerung möglich sind. Um diese Funktion erfüllen zu können, müssen Bürger:innenräte besser institutionalisiert werden als in ihrer gegenwärtigen unverbindlichen Form. Deshalb sollten sie als eigene Kammerin einem neuen Rat für Nachhaltigkeit eingerichtet werden, der im Deutschen Bundestag angesiedelt ist.
Um Bürger:innenräte enger in den Gesetzgebungsprozess einzubinden, sollten sie in Orientierunsgsdebatten zu besonders umfassenden und kontroversen Transformationsvorhaben Stellung beziehen können. Die politische Entscheidung über konkrete Transformationsvorhaben verbliebe bei Bundestag und Bundesregierung, da nur diese durch eine freie und gleiche Wahl dazu legitimiert sind. Eine Entscheidungsgrundlage wären dann aber eingehende und informierte Debatten von Bürger:innen, die mögliche Kompromisslinien aufzeigen können.
Gebiet
Während sich die Klimakrise global auswirkt, ist die Demokratie weitgehend auf den Nationalstaat begrenzt. Eine global wirksame und demokratisch kontrollierte Klimapolitik lässt sich am besten durch eine Demokratisierung der Europäischen Union (EU) erreichen. Gegenwärtig gerät die EU zunehmend unter Druck autoritärer Populist:innen. Ein Grund dafür sind fortbestehende Demokratiedefizite der EU selbst. Diese sollten durch eine weitere Demokratisierung der EU behoben werden.
Ein besonders problematisches Demokratiedefizit ist, dass die Wahlen zum Europäischen Parlament weiterhin stark durch nationale Debatten geprägt und kaum auf europäische Politik ausgerichtet sind. Das erleichtert radikalen Populist:innen eine Instrumentalisierung für nationalistische Zwecke. Vordringlich sind deshalb zwei Maßnahmen, die zur Schaffung eines transnationalen Wahlraums beitragen können und die keiner Änderungen der EU-Verträge bedürfen: Eine Harmonisierung des Wahlrechts für das Europäische Parlament sowie ein verbindliches Spitzenkandidatensystem für die Europäische Kommission.
Durch diese Maßnahmen kann die Akzeptanz einer ambitionierten EU-Klimapolitik erhöht und langfristig gesichert werden. Darüber hinaus sollte es, insbesondere im Falle einer Erweiterung der EU, einen partizipatorischen Prozess für Vertragsänderungen geben, um die Handlungsfähigkeit der EU durch eine Ausweitung von Mehrheitsentscheidungen im Europäischen Rat zu sichern.
Innocracy23
Dieses Diskussionspapier ist ein Beitrag zur Debatte über das Verhältnis von Demokratie und Klimakrise, wie sie sich nach der Innocracy23 entwickelt hat. Die Innocracy23 fand am 17. November 2023 im Berliner Amplifier unter dem Titel „Demokratiepolitik in der Klimakrise“ statt. Dabei haben wir uns im Programm an vier Spannungsfeldern zwischen Demokratie und Klimakrise orientiert, die parallel wirken und sich wechselseitig verstärken: Geschwindigkeit, Gesellschaft, Gebiet und Generation.
Die Innocracy
Zwischen 2017 und 2025 hat sich die Innocracy erfolgreich als große zivilgesellschaftliche Konferenz zu demokratischen Innovationen und der Transformation etabliert. Gemeinsam mit Partner:innen entwickeln wir Analysen und Visionen für eine resiliente Demokratie.
Autor:innen
Synopsen der Innocracy25: Wie hältst Du’s mit der Demokratie?
How to Sell Democracy Online (Fast)
Wer sind die Neuen?
POV: Wahlkampf

Wir entwickeln und debattieren Ideen für den gesellschaftlichen Fortschritt – und bringen diejenigen zusammen, die sie in die Tat umsetzen. Unser Ziel als Think Tank: das Gelingen einer gerechten Transformation. ▸ Mehr erfahren