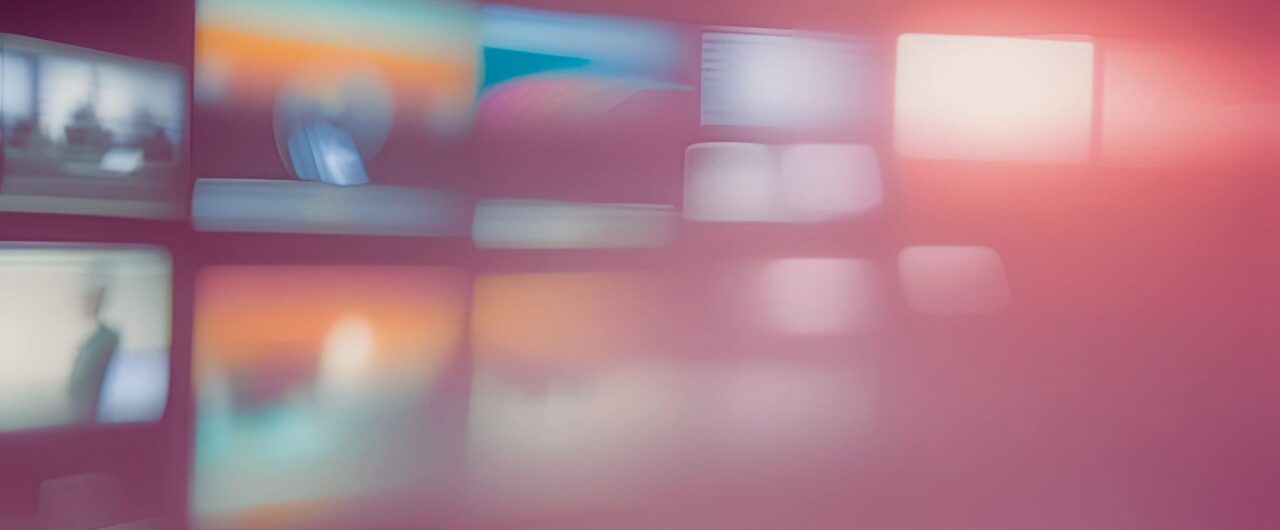Ausgangspunkt der Debatte: Der öffentlich-rechtliche Rundfunk (ÖRR) soll qua Auftrag ein Stabilitätsanker unserer Demokratie sein. Im besten Fall bietet er qualitativ hochwertige Inhalte, fachliche Einordnungen und Faktenchecks, ist ein Bollwerk gegen staatliche Zensur oder privatwirtschaftlich vereinnahmte Plattformen und trägt zur individuellen und öffentlichen Meinungsbildung bei. Durch den ÖRR gesicherte freie Kommunikationsräume stärken den gesellschaftlichen Zusammenhalt und letztlich die Demokratie.
Die Ansprüche an den ÖRR sind berechtigterweise hoch, das Vertrauen in seine Organisationen und Akteure aber beschädigt, sein Ruf angegriffen von populistischen und extremen Kräften. Vor diesem Hintergrund debattierten wir mit Heike Raab, Staatssekretärin der Staatskanzlei Rheinland-Pfalz und Koordinatorin der Rundfunkkommission der Länder, Yvette Gerner, Intendantin bei Radio Bremen und Florian Grotz, Professor für Politikwissenschaften an der Universität Hamburg und einem breiten Publikum zur Fragestellung: Wie kann der ÖRR seinem demokratischen Auftrag wieder stärker nachkommen?
Mit Reformen gegen Bedeutungsverlust und Kritik
Heike Raab benannte die offensichtlichen Probleme: Intern kämpfe man mit Bedeutungsverlust, aufgeblähten Strukturen und Skandalen, extern mit Rechtsruck, Politikverdrossenheit und Desinformation. Gleichzeitig habe man das Problem, viele, vor allem jüngere Menschen, nicht mehr zu erreichen. Um nach wie vor den demokratischen Auftrag des ÖRR erfüllen zu können, brauche es daher Anpassungen und Reformen.
Ein Mittel dazu sei der Staatsvertrages zur Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, der am 1. Dezember 2025 in Kraft treten soll. „Der Reformstaatsvertrag schafft die Basis für diesen Wandel”, so Raab. Ein Ziel sei unter anderem die Entwicklung eines großen Streamingnetzwerkes, zu dessen Finanzierung allerdings Einsparungen etwa bei den Hörprogrammen notwendig seien. Umso wichtiger erscheint eine verlässliche Finanzierungsperspektive: „Man darf nicht zum politischen Spielball werden, damit der Auftrag des ÖRR parteiunabhängig erfüllt werden kann”, so Raab.
Verifizierte Fakten: vom Gatekeeper zum Truthkeeper
Yvette Gerner stellte den Kern des öffentlich-rechtlichen Auftrags heraus: „Wahrheit ist kein individuelles Konstrukt – es geht darum, unabhängig solide Fakten herzustellen.” In Redaktionen habe ein Wandel von Gatekeeping, also dem Selektieren von Informationen, hin zu Truthkeeping, dem Verifizieren und Korrigieren von Fakten, stattgefunden. Man leiste einen Beitrag zur Aufklärung und Wahrheitsfindung, müsse aber gleichzeitig transparenter sein und selbstkritisch mit Fehlern umgehen.
Gerner bekräftigte die positive Bedeutung des Reformstaatsvertages für einen zeitgemäßen und modernen ÖRR. Es sei nun klar, wo Einsparungen stattfinden werden und man arbeite bereits verstärkt an einer effizienteren Zusammenarbeit sowie einer technischen Vereinheitlichung. Aufgrund der veränderten Mediennutzung würden Gelder vom linearen Angebot in non-lineare Angebote umgeschichtet. Auch wenn es noch einiges zu tun gebe, zeigt sich Gerner optimistisch; seit 2021 habe die ARD eine 70-prozentige Steigerung bei den Abrufen digitaler Angebote erzielt.
Lokaljournalismus – die dezentrale Öffentlichkeit bewahren
Man dürfe sich aber natürlich nicht aus der analogen Welt zurückziehen. Um Vertrauen und Verständnis für den ÖRR aufzubauen, müsse man weiterhin den direkten Dialog mit der Gesellschaft suchen und echte Begegnungen schaffen – wie etwa Radio Bremen, das Stadtteilgespräche und Kulturevents zu diesem Zweck veranstalte.
Florian Grotz ergänzte den Blick aus der Forschung. Wie wichtig das Vor-Ort-Sein von Journalismus ist, belege eine aktuelle Studie. Dort, wo Lokalzeitungen im Niedergang sind, zeige sich auch eine erhöhte politische Polarisierung. Es gelte daher, dezentrale Öffentlichkeiten zu bewahren, was laut Grotz aufgrund des föderalen Systems eine große Stärke Deutschlands sei. Seiner Einschätzung nach sei das deutsche Mediensystem sehr resilient gegen illiberale Bestrebungen, da es historisch gut ausbalanciert und institutionalisiert sei. Gleichzeitig mache genau dies es schwierig, Modernisierungsanpassungen vorzunehmen.
Mit Partizipation gegen die Intransparenz
Laut Grotz stelle sich außerdem die Frage nach der gesamtgesellschaftlichen Legitimation. Früher sei der ÖRR ein Monopolist gewesen, heute habe man die Wahl zwischen diversen Abo-Kanälen. So entstehe eine Heterogenität an Erwartungen, wofür die Rundfunkgebühren verwendet werden sollen. Die Reform des Mediensystems bleibe daher Daueraufgabe. Um Vertrauen zurückzugewinnen, müssten die Reformprozesse transparent kommuniziert und die Öffentlichkeit stärker einbezogen werden.
Heike Raab und Yvetter Gerner pflichten dem bei. Die Vorwürfe von Intransparenz habe man häufiger gehört und mit Reformen reagiert – auch wenn diese aufgrund des föderalen Systems schwierig umzusetzen seien. Es fänden nun regelmäßig Befragungen oder andere Beteiligungsformate statt; auch sei die Gremienstruktur gestärkt worden. Bei Radio Bremen sei Transparenz bei der Arbeit vorgeschrieben und die Vielfalt der Gremien sei tatsächlich häufig größer als öffentlich diskutiert.
So könnten sich zum Beispiel auch Bürger:innen beim Rundfunkrat bewerben. Laut Gerner müsse die Personalzusammenstellung jedoch noch mit mehr Vielfalt erfolgen, wofür auch eine Anpassung des Prozesses notwendig sei. Auch Raab sieht Verbesserungsbedarf – vor allem bei der Repräsentation von verschiedenen Bevölkerungsgruppen in den Gremien. Außerdem müsse man noch deutlicher machen, wofür die Rundfunkbeiträge verwendet werden.
Auf den Medienwandel richtig reagieren
In der Diskussion ergänzte ein Teilnehmer aus dem Publikum, die Herausforderungen des Medienwandels würden nicht ausreichend wahrgenommen. Statt Sender zu streichen, müsse man eine Antwort auf Medienkonglomerate aus den USA entwerfen. Yvette Gerner entgegnete, eine Regulierung dieser Plattformen wäre wünschenswert, eine eigene Social-Media-Plattform aufzubauen sei jedoch extrem schwierig. Man setze stattdessen auf Dialogangebote auf den eigenen Plattformen.
Heike Raab ergänzte, dass man den Digital Services Act (DSA) der EU von einem Schönwetter- zu einem Extremwettergesetz umwandeln müsse. Zur Kritik der Senderzusammenlegung gab Raab zu bedenken, dass man sich nicht alles leisten könne und die Aufteilung in zu viele Sparten auch nicht unbedingt dabei helfe, ein breites Publikum zu erreichen. Für das Jugendangebot „Funk” beispielsweise mussten zwei andere Formate eingestellt werden, dafür spreche man aber nun ein jüngeres Publikum an.
Gesellschaftlichen Austausch organisieren
Leonard Novy, Journalist und Direktor des Instituts für Medien- und Kommunikationspolitik, fasst die Debatte am Ende so zusammen: Systemische Zusammenhänge und verschiedene Perspektiven müssten stärker innerhalb einzelner Formate sichtbar werden, statt sie nur auf viele unterschiedliche Angebote zu verteilen. Nur so würden gesellschaftliche und globale Komplexität auch sichtbar. Den gesellschaftlichen Austausch mit anzuregen und auch mitzuorganisieren, das sei Aufgabe des ÖRR.
In der Veranstaltung wurde deutlich, die Herausforderungen sind groß und vielfältig – die Ansatzpunkte aber sind es auch. Der (Rund)Funke muss endlich überspringen – nicht für gute Unterhaltung, sondern für eine resiliente Demokratie.